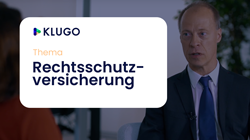- Das Wichtigste in Kürze
- Was bedeutet Rückgaberecht?
- Gibt es ein Rückgaberecht im stationären Einzelhandel?
- Gibt es ein Rückgaberecht bei Online-Käufen?
- Gibt es bei Privatkäufen ein Rückgaberecht?
- Was ist der Unterschied zwischen Rückgaberecht, Widerrufsrecht und Umtauschrecht?
- Umtauschrecht
- Rückgaberecht
- Widerrufsrecht
- Welche Bedingungen sind an das Rückgaberecht gebunden?
- Wie lange gilt das Rückgaberecht?
- Welche Rechte hat man bei Mängeln?
- Wie lange kann man Waren oder Dienstleistungen reklamieren?
- Wer trägt die Versandkosten bei einer Rückgabe?
- Welche Besonderheiten gibt es bei Sonderanfertigungen?
- Wie kann Ihnen ein KLUGO Partner-Anwalt beim Rückgaberecht weiterhelfen?
Rückgaberecht
Jeder hat schon einmal eine Ware gekauft, die im Anschluss nicht gefallen hat. Ob ein Anbieter die Ware zurücknehmen muss, hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab. Man unterscheidet zwischen Rückgaberecht, Widerrufsrecht und Umtauschrecht. Wir erklären, worauf es bei einer Rückgabe ankommt und wann eine Rückgabe ausgeschlossen werden kann.
Das Wichtigste in Kürze
- Bei Käufen vor Ort im Ladengeschäft hat man als Kunde kein rechtliches Rückgaberecht.
- Anders sieht es dagegen bei Online-Käufen aus. Da hier die Ware vorab nicht begutachtet werden kann, gilt hier ein 14tägiges Rückgaberecht auf alle Produkte.
- Wer eine Ware zurückgeben möchte, sollte jedoch auch das Widerrufsrecht und das Umtauschrecht in Betracht ziehen.
- Zu den gesetzlichen Regelungen gibt es auch immer wieder spezifische Sonderfälle, die anderen Gesetzen unterliegen – zum Beispiel Sonderanfertigungen oder Privatverkäufe.
- Ein KLUGO Partner-Anwalt für Vertragsrecht hilft Ihnen dabei, rund um das Thema Rückgaberecht den Überblick zu behalten.
Was bedeutet Rückgaberecht?
Unter dem Begriff Rückgaberecht versteht man das Recht eines Kunden, eine gekaufte Ware beim Anbieter ohne Angabe von Gründen zurückgeben zu können. Damit unterscheidet es sich klar vom Umtauschrecht oder Widerrufsrecht. Viele Kunden gehen davon aus, dass alle Waren unter das gängige Rückgaberecht fallen – das ist jedoch falsch. Für Verbraucher ist es nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, die Ware ohne Grund zurückzugeben. Anders sieht es natürlich bei Sachmängeln oder Rechtsmängeln aus. Und auch Sonderanfertigungen müssen beim Rückgaberecht gesondert betrachtet werden. In diesem Beitrag werden wir genauer darauf eingehen, was das Rückgaberecht bedeutet und wann man als Verbraucher die Möglichkeit hat, Waren an den Hersteller zurückzugeben.
Gibt es ein Rückgaberecht im stationären Einzelhandel?
Obwohl viele Kunden davon ausgehen, dass auch im stationären Einzelhandel – also im Ladengeschäft vor Ort – gekaufte Waren binnen einer gewissen Frist zurückgegeben werden können, ist dies nicht der Fall. Wer im Laden gekaufte Produkte zurückgeben möchte, muss daher auf die Kulanz des Verkäufers setzen. Oftmals wird trotz der Tatsache, dass hier kein Rückgaberecht besteht, eine Kulanzfrist eingeräumt, binnen derer Produkte ohne Probleme zurückgenommen werden, sofern diese bisher ungenutzt sind. Wie lange die Frist ist, bestimmt dabei jeder Händler selbst.
Gibt es ein Rückgaberecht bei Online-Käufen?
Da der Kunde bei einem Online-Kauf die Ware nicht vorab sehen und begutachten kann, hat der Gesetzgeber bei Online-Käufen ein gesetzliches Rückgaberecht eingeräumt. Im Fernabsatzgesetz ist geregelt, dass mindestens ein 14-tägiges Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen für alle Kunden besteht. Verkäufer haben natürlich die Möglichkeit, diese Frist unbegrenzt zu verlängern. Das sogenannte Widerrufsrecht beginnt ab dem Tag des Warenerhalts, wenn der Kunde in Schriftform – zum Beispiel mit dem Bestätigen der AGB – über das Widerrufsrecht informiert wurde. Teilt der Händler dem Kunden die Bedingungen zum Widerruf nicht schriftlich mit, erlischt das Widerrufsrecht erst nach einem Jahr und 14 Tagen, nachdem der Kunde die Ware erhalten hat. Möchte man als Kunde vom gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch machen, genügt es völlig, die Ware zum Händler zurückzusenden. Gründe für die Rücksendung müssen dabei nicht angegeben werden.
Als Verbraucher können Sie entgegen der verbreiteten Meinung bei Nichtgefallen nicht einfach so die Ware zurückgeben. Das Rückgaberecht im stationären Handel stellt eine freiwillige Leistung des Verkäufers dar. Im Onlinehandel gibt es ein gesetzliches Rückgaberecht, das sog. Widerrufsrecht, welches nach § 355 BGB 14 Tage beträgt."Pierre Torster
Rechtsanwalt Ass. jur. Dipl. jur.
Gibt es bei Privatkäufen ein Rückgaberecht?
Bei Privatkäufen, selbst wenn diese über das Internet oder Online-Verkaufsplattformen stattgefunden haben, hat man als Kunde ebenfalls kein Rückgaberecht. Hier gilt: Gekauft wie gesehen. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Hat der Verkäufer den Käufer arglistig getäuscht oder weist die gekaufte Sache Sachmängel auf, so kann auch bei einem Privatverkauf eine Rückgabe erfolgen. Die Umsetzung dieses Rückgaberechts gestaltet sich jedoch meist schwierig, da nur wenige Privatverkäufer bereitwillig eine bereits verkaufte Ware zurücknehmen. In diesem Fall hilft daher oft nur der gerichtliche Weg mit einem Rechtsanwalt.
Was ist der Unterschied zwischen Rückgaberecht, Widerrufsrecht und Umtauschrecht?
Als Verbraucher unterscheidet man meist nicht zwischen Rückgaberecht und Umtauschrecht. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden beide Worte für die Rückgabe von Waren verwendet. Der Gesetzgeber unterscheidet jedoch klar zwischen Umtauschrecht und Rückgaberecht. Beide Varianten sind zumindest im stationären Handel freiwillige Kulanzleistungen, die nicht vom Händler verlangt werden können. Bietet dieser jedoch von Haus aus ein Rückgaberecht oder Umtauschrecht an, ist er an diese Entscheidung gebunden und muss jedem Kunden diese Sonderrechte gewähren.
Umtauschrecht
Wenn der Händler ein Umtauschrecht gewährt, kann man als Kunde die Ware einfach zurückgeben, wenn diese nicht gefällt. Allerdings erhält er dafür nicht sein Geld zurück, sondern lediglich die Möglichkeit, sich vor Ort andere Waren auszusuchen oder einen Gutschein zu erhalten, der beim nächsten Einkauf im Geschäft eingelöst werden kann.
Rückgaberecht
Anders sieht es dagegen beim Rückgaberecht aus. Räumt der Händler den Kunden ein Rückgaberecht ein, kann dieser die Waren ohne Angabe von Gründen zurückgeben. Statt anderen Waren oder eines Gutscheins muss hier jedoch der Kaufpreis erstattet werden. Räumt der Händler ein Rückgaberecht ein, muss er zudem selbst für alle Kosten der Rücksendung aufkommen.
Widerrufsrecht
Im Grunde handelt es sich beim Widerrufsrecht ebenfalls um ein Rückgaberecht, das allerdings anderen Bedingungen unterliegt. Das Widerrufsrecht besteht meist für einen Zeitraum von 14 Tagen. In dieser Zeit können die Vertragsparteien also ihre Meinung ändern und den Vertrag widerrufen. Das Widerrufsrecht ist freiwillig, aber empfehlenswert.
Beim Widerrufsrecht muss grundsätzlich der Käufer die Rücksendungskosten tragen, sofern er vom Unternehmer darauf hingewiesen wurde und letzterer sich nicht zur Kostenübernahme bereit erklärt (§ 357 Abs. 6 BGB).
Welche Bedingungen sind an das Rückgaberecht gebunden?
Wenn ein Händler freiwillig ein Rückgaberecht für seine Kunden einräumt, hat er gleichzeitig das Recht, dieses an bestimmte Bedingungen zu knüpfen – zumindest im lokalen Einzelhandel. Meist werden die Bedingungen vor Ort über einen Aushang kommuniziert.
Zu den möglichen Einschränkungen des Rückgaberechts zählen:
- Rückgabe der Waren nur gegen Vorlage des Kassenbons oder der Rechnung
- Die Rückgabe kann nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfolgen, z. B. eine 14 Tage Frist ab Kaufdatum
- Reduzierte Waren können von Austausch und Rückgabe ausgeschlossen werden
- Sonder- und Maßanfertigungen müssen nicht zurückgenommen werden, da sie speziell auf den Kunden zugeschnitten wurden
- Unterwäsche und Bademode kann aus hygienischen Gründen vom Rückgaberecht ausgeschlossen werden
- Die Ware muss originalverpackt und im Originalzustand sein, wenn sie zurückgegeben werden soll

Einige Händler nutzen all diese Beschränkungen für das freiwillige Rückgaberecht oder Umtauschrecht, andere nutzen nur manche dieser Möglichkeiten. Es lohnt sich also, vor dem Kauf genau zu prüfen, wie die individuellen Rückgabevorschriften des Verkäufers aussehen.
Wie lange gilt das Rückgaberecht?
Im lokalen Einzelhandel besteht nur dann ein Rückgaberecht, wenn dieses explizit vom Händler eingeräumt wurde. Wie lang die möglichen Fristen für eine Rückgabe der gekauften Waren sind, legt daher auch der Händler selbst fest.
Bei Online-Käufen besteht jedoch auch ein gesetzliches Rückgaberecht bzw. Widerrufsrecht. Kunden haben hier die Möglichkeit, die Waren bis zu 14 Tage nach dem Kauf ohne Angabe von Gründen an den Händler zurückzugeben. Wichtig ist, dass man seitens des Händlers explizit auf dieses Recht hingewiesen worden sein muss. Dies kann zum Beispiel über eine Bestätigung der AGB oder eine Zusendung selbiger per E-Mail erfolgen. Wurde man als Kunde nicht über das Rückgaberecht informiert, verlängert sich die Frist automatisch um ein Jahr.
Welche Rechte hat man bei Mängeln?
Auch wenn ein gekauftes Produkt einen Mangel aufweist, hat man nicht automatisch ein Rückgaberecht. Stattdessen greift in diesen Fällen die sogenannte Gewährleistung laut § 437 BGB. Diese Gewährleistungsfrist gilt für mindestens zwei Jahre nach dem Kauf (§ 438 BGB). Aber: Weist ein gekauftes Produkt einen Mangel auf, ist der Händler zunächst nicht zur Rücknahme verpflichtet. Stattdessen hat der Gesetzgeber hier einen Anspruch auf Nacherfüllung eingeräumt. Heißt konkret: Dem Händler muss die Möglichkeit gegeben werden, das mangelhafte Produkt zu reparieren. Alternativ kann er auch ein Ersatzprodukt zusenden, wobei die defekte oder beschädigte Ware meist zunächst zurückgesendet werden muss. Dafür kann man dem Händler als Käufer eine Frist setzen, binnen derer das Produkt repariert oder ausgetauscht werden muss. Diese Frist muss sich jedoch in einem durchsetzbaren Rahmen bewegen, mangelhafte Produkt zu reparieren.
Entscheidet man sich für eine Reparatur des Produkts, hat der Verkäufer gemäß § 440 BGB zwei Versuche, ehe alle Mängel am Produkt vollständig beseitigt sein müssen. Ist dies nicht der Fall, kann man als Käufer vom Vertrag zurücktreten und sich das Geld zurückerstatten lassen. Hält der Händler sich nicht an die gewährten Reparaturfristen, ist ein Rücktritt vom Vertrag unter Umständen auch schon früher möglich.

Die Gewährleistungsfrist für gekaufte Waren beträgt 2 Jahre. Bei Dienstleistungen von Handwerkern kann die Gewährleistung aber auf bis zu fünf Jahre angehoben werden. Handelt es sich um einen Neubau, ist die Gewährleistungsfrist automatisch länger als bei Reparaturen.
Wie lange kann man Waren oder Dienstleistungen reklamieren?
Ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Kaufgegenstandes im Ladengeschäft oder ab dem Zeitpunkt, an dem eine online bestellte Ware geliefert wird, beginnt die Gewährleistungsfrist. Diese umfasst zwei Jahre. Weist die Ware allerdings schon vor dem Verkauf einen Mangel auf und der Händler verschweigt diese, ist von einer arglistigen Täuschung auszugehen. In diesem Fall verlängert sich die Gewährleistungsfrist auf drei Jahre.
Innerhalb dieser Frist hat man als Käufer das Recht, die Ware vom Händler reparieren oder austauschen zu lassen. Oftmals steht einem frei, welche der beiden Varianten man wählt. Entscheidet man sich für die Reparatur, müssen dem Händler zwei Reparaturversuche innerhalb einer vorgeschriebenen Frist eingeräumt werden. Kommt der Händler dieser Aufforderung nicht nach oder gelingt die Reparatur nicht, kann man als Käufer vom Vertrag zurücktreten und sein Geld zurückfordern.
Anders sieht es zudem bei der Gewährleistungsfrist für handwerkliche Dienstleistungen aus. Hier hängt die Dauer der Gewährleistung davon ab, um welche handwerkliche Tätigkeit es sich handelt. Bei Neubauten gilt eine Gewährleistungsfrist von 5 Jahren, die auf alle Arbeiten an den Gebäuden gewährt wird. Bei Reparaturen ist die Gewährleistungsfrist niedriger.
Wer trägt die Versandkosten bei einer Rückgabe?
Soll im Online-Shop gekaufte Ware an den Händler zurückgesendet werden, fallen Kosten für den Rückversand an. Ob diese vom Händler oder Käufer zu tragen sind, ist immer abhängig vom Warenwert und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Online-Shops. Grundsätzlich muss der Käufer die Kosten für den Rückversand der Ware tragen, sofern er vom Unternehmer darauf hingewiesen wurde und dieser sich nicht zur Kostenübernahme bereit erklärt. Viele Händler bieten aber einen kostenlosen Rückversand der Waren an.

Wird ein Produkt innerhalb der 14-tägigen Rückgabefrist ohne Angabe von Gründen zurückgegeben, muss der Verkäufer nicht nur den Warenwert erstatten, sondern auch die fällig gewordenen Versandkosten. Prüfen Sie daher immer die Rückzahlung auf Vollständigkeit!
Welche Besonderheiten gibt es bei Sonderanfertigungen?
Ob eigens angefertigte Möbelstücke, auf den Käufer angepasste Kleidungsstücke oder individuell gestaltete Bilder – bei Sonderanfertigungen aller Art gibt es kein Widerrufsrecht. Das gilt in diesem Fall auch bei Online-Käufen, wie das Landgericht Düsseldorf am 12.02.2014 entschieden hat (Aktenzeichen 23 S 111/13 U). Das hat den Hintergrund, dass ein Händler ein Produkt, das für einen einzigen Kunden hergestellt und gestaltet wurde, nur schwer an andere Kunden weiterverkaufen könnte. Da dies für den Händler immer dann, wenn ein Kunde eine Sonderanfertigung zurückgeben möchte, einen großen finanziellen Schaden bedeuten würde, hat der Gesetzgeber diese Möglichkeit von vornherein ausgeschlossen. Die üblichen Gewährleistungspflichten gelten jedoch auch bei Sonderanfertigungen. Heißt konkret: Wenn ein eigens für den Verbraucher angefertigtes Produkt Sachmängel aufweist, ist der Händler auch hier zu Reparaturen und Nachbesserungen verpflichtet. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, kann man als Verbraucher vom Kaufvertrag zurücktreten und das Geld zurückverlangen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auch in unserem Beitrag zum Thema Widerruf bei kundenspezifisch hergestellten Waren.
Wie kann Ihnen ein KLUGO Partner-Anwalt beim Rückgaberecht weiterhelfen?
Die Rückgabe von Waren gestaltet sich nicht immer ganz einfach. Während der 14tägigen Rückgabefrist von Online-Versandwaren können Sie die Waren ganz einfach und ohne Angabe von Gründen an den Händler zurücksenden. Ist diese Frist verstrichen, ist eine Rückgabe oft nur noch schwer möglich. Kommt es zu Mängeln, müssen diese umgehend dem Verkäufer gemeldet werden, damit dieser Ersatz liefern oder eine Reparatur durchführen kann.
Ein KLUGO Partner-Anwalt kann Ihnen behilflich sein, wenn Sie unschlüssig aufgrund der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Händlers und der Einhaltung relevanter Fristen sind. Besonders hilfreich ist die anwaltliche Unterstützung vor allem dann, wenn Sie eine arglistige Täuschung oder einen Betrug vermuten. Oftmals müssen hier rechtliche Schritte eingeleitet werden, um vom Rückgaberecht Gebrauch zu machen und das Geld zurückzuerhalten. Im Rahmen einer Ersteinschätzung kann ein Fachanwalt für Vertragsrecht eine erste Orientierung zu Ihrem Fall bieten und mit Ihnen weitere Vorgehensweisen besprechen.
Sie haben eine Rechtsfrage?
Dann nutzen Sie einfach die KLUGO Erstberatung. Die Erstberatung ist ein Telefongespräch mit einem zertifizierten Anwalt aus unserem Netzwerk.
Beitrag juristisch geprüft von der KLUGO-Redaktion
Der Beitrag wurde mit großer Sorgfalt von der KLUGO-Redaktion erstellt und juristisch geprüft. Dazu ergänzen wir unseren Ratgeber mit wertvollen Tipps direkt vom Experten: Unsere spezialisierten Partner-Anwälte zeigen auf, worauf es beim jeweiligen Thema ankommt.